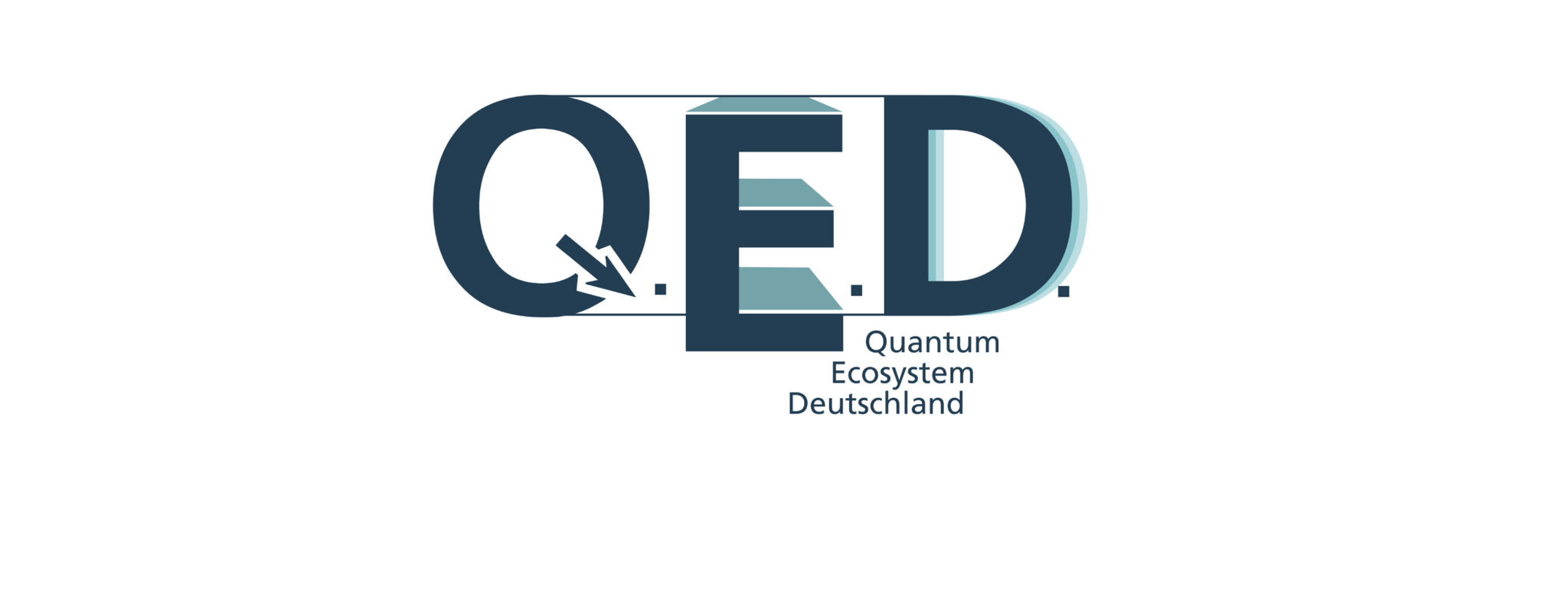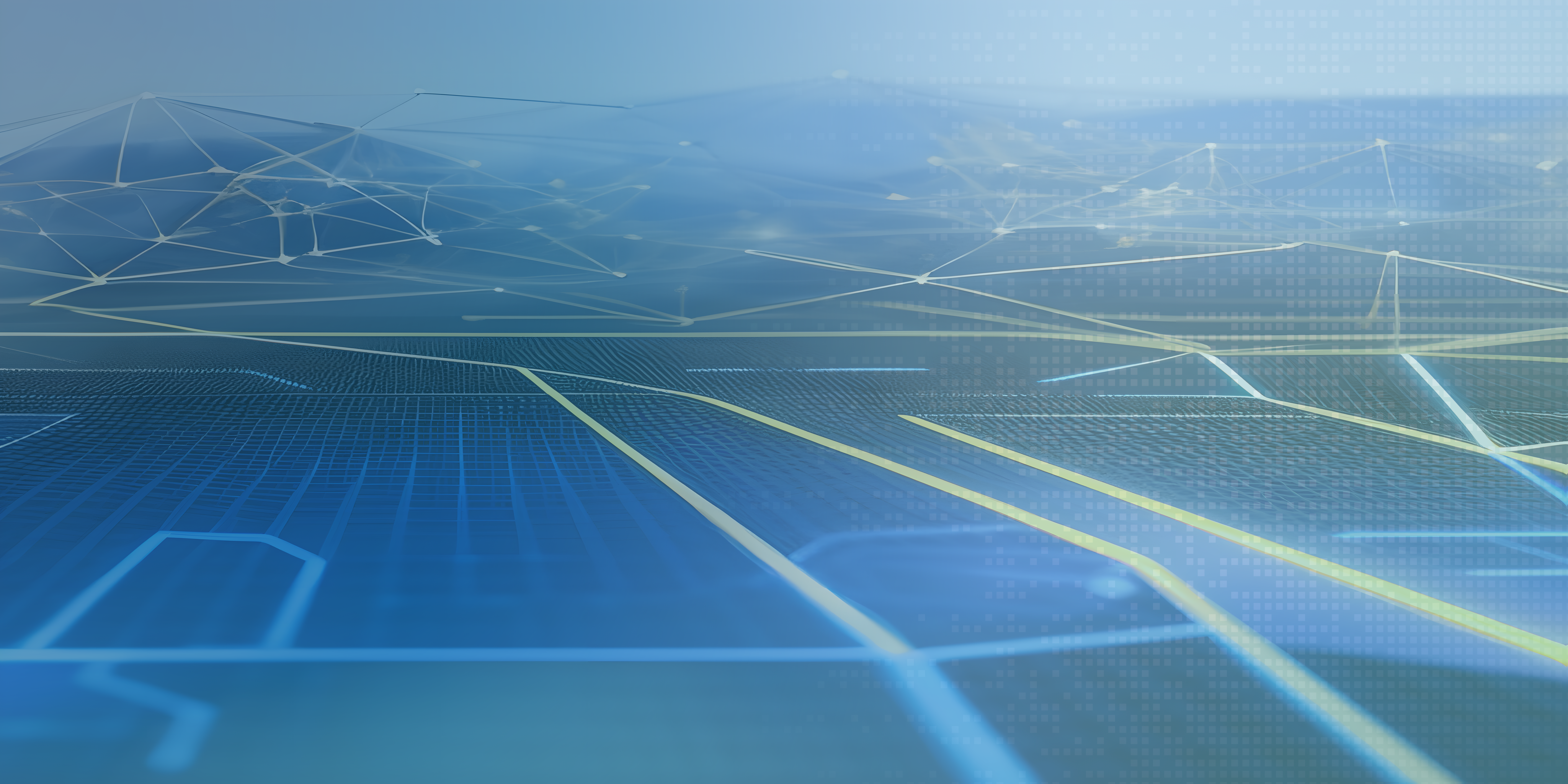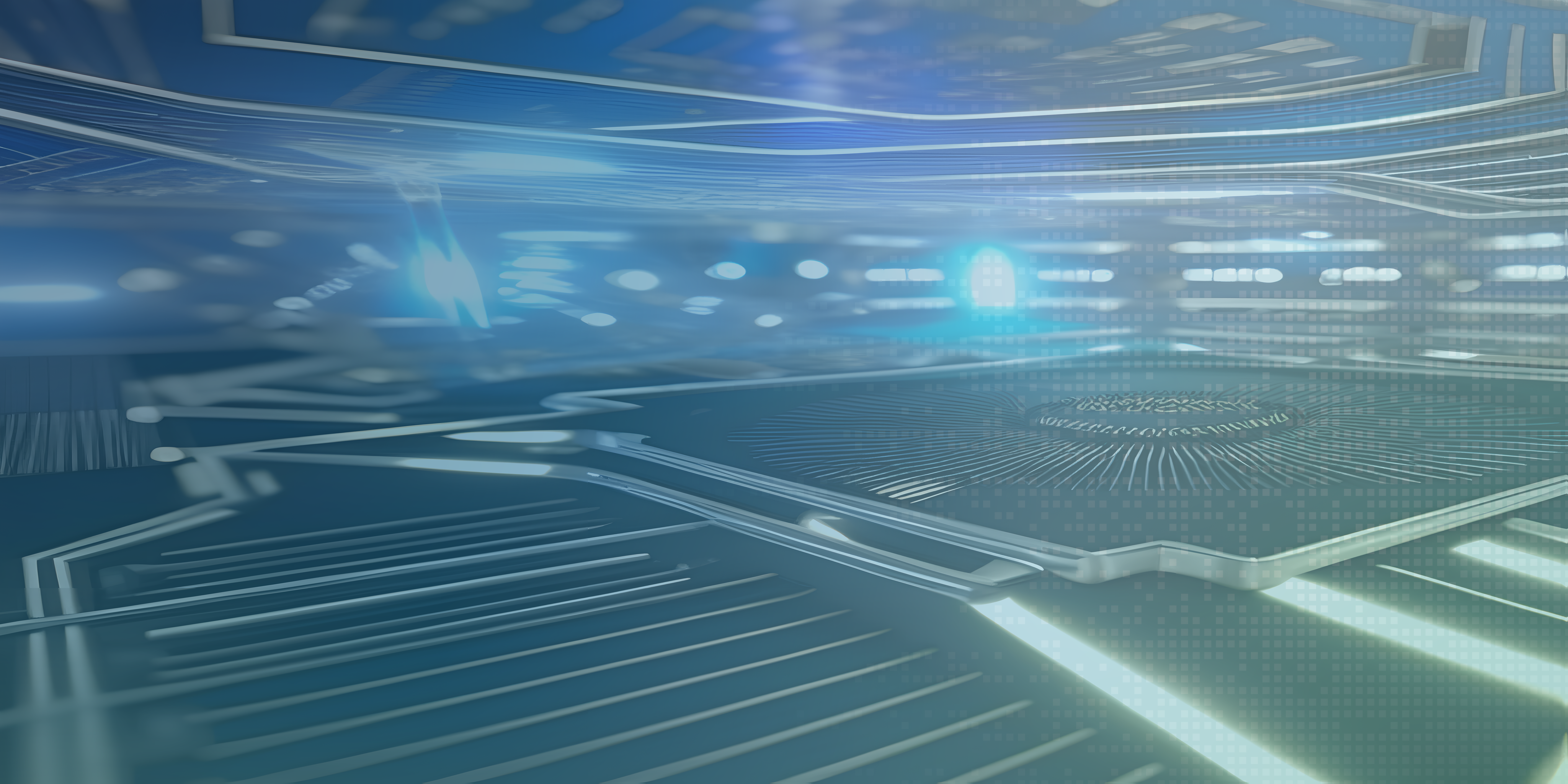Im Mittelpunkt des Halbzeit-Statustreffens stehen die Präsentationen vonnProjekten der »Quantencomputing-Demonstrationsaufbauten«, bei denen verschiedene Konsortien ihre bisherigen Erfolge und die nächsten Schritte vorstellen. Begleitet wird das Treffen durch wissenschaftliche Beiträge unter anderem aus dem Q.E.D.-Projekt, das die Aktivitäten der Demonstrationsaufbauten wissenschaftlich unterstützt und analysiert.
»Das Projekt »Quantum Ecosystem Deutschland« zeigt eindrucksvoll, wie es uns gelingt, Forschung und Innovationen im Bereich des Quantencomputing zusammenzubringen. Die Halbzeitmarke der Projekte der Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten verdeutlicht den großen Fortschritt, den wir auf dem Weg zur Stärkung der technologischen Souveränität Deutschlands in geopolitisch angespannten Zeiten bereits erreicht haben. Die beeindruckenden Erfolge »Made in Germany« sind die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit unserer Industrie in der Zukunft,« erklärte Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, anlässlich der Konferenz zum Status der Forschung zu Quantencomputing.
Quantum Ecosystem Deutschland – Fortschritt in der Quantenforschung
Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie arbeitet das Q.E.D.-Team unter der Leitung des Fraunhofer IMW daran, ein international wettbewerbsfähiges und souveränes Quantencomputing-Ökosystem in Deutschland unter die Lupe zu nehmen und dessen Aufbau wissenschaftlich zu begleiten. Durch die Vernetzung verschiedener Akteure und den Wissenstransfer sollen die technischen Grundlagen geschaffen werden, um langfristig führende Quantencomputing-Technologien zu entwickeln.
Dr. Friedrich Dornbusch, Abteilungsleiter Regionale Transformation und
Innovationspolitik am Fraunhofer IMW, der die wissenschaftliche Begleitung des Q.E.D.-Projekts koordiniert, gibt am ersten Tag des Treffens einen Überblick über die bisherigen Forschungsergebnisse und Erkenntnisse von Q.E.D. Die Veranstaltung wird von einer Panel Diskussion mit Vertreter:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Fachvorträgen aus den BMBF-Projekten der Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten, einer Poster-Ausstellung sowie einer Networking-Möglichkeit begleitet, die den Austausch zwischen den Teilnehmenden fördert.
Zukunftsperspektiven des Quantencomputings in Deutschland
Neben der Präsentation der Q.E.D.-Ergebnisse und den Ergebnissen aus den BMBF-Fachprojekten erwartet die Teilnehmenden am zweiten Tag ein Vortrag von Prof. Seth Lloyd vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), der als international renommierter Quantenforscher spannende Einblicke in die aktuellen globalen Entwicklungen im Quantencomputing gibt. Im Anschluss daran werden die DLR Quantencomputing-Initiative und die Bundesdruckerei ihre Aktivitäten vorstellen und die strategische Bedeutung des Quantencomputing für Deutschland aus ihrer Perspektive beleuchten.
Begleit- und Vernetzungsprojekt »Quantum Ecosystem Deutschland (Q.E.D.)«
Das sozioökonomische Begleit- und Vernetzungsprojekt »Quantum Ecosystem Deutschland (Q.E.D.)« unterstützt die BMBF‐Fördermaßnahme »Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten« durch wissenschaftliche Analysen, die Bereitstellung von Strategiewissen und methodischen Beiträgen zur aktiven Vernetzung. So wird das in zwei Module unterteilte Projekt Gestaltungsansätze für den mittel- bis langfristigen Aufbau eines technologisch souveränen und international wettbewerbsfähigen Quantencomputing-Ökosystems in Deutschland entwickeln.
BMBF‐Fördermaßnahme »Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten«
Die BMBF‐Fördermaßnahme »Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten« befördert, neben wissenschaftlich‐technischen Ergebnissen, den Auf- und Ausbau souveräner
Innovations‐ und Wertschöpfungsnetzwerke im Quantencomputing in Deutschland. Mittel‐ bis langfristig soll ein technologisch souveränes und international wettbewerbsfähiges Quantencomputing‐Ökosystem in Deutschland entstehen.
Mit hoher Geschwindigkeit sollen somit neue Anwendungen und Produkte auf den internationalen Märkten etabliert werden. Hierbei sind eine Reihe von innovations‐ und sozioökonomischen Herausforderungen zu bewältigen.
MEHR ZUM FORSCHUNGSPROJEKT QUANTUM ECOSYSTEM DEUTSCHLAND Q.E.D. ERFAHREN SIE HIER:
Projekt-Website: https://www.imw.fraunhofer.de/de/forschung/reg-transformation-innovationspol/innovationspolitik/projekte/QED.html
Q.E.D. @ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qed-fraunhofer-imw
MEHR ZU DEN QUANTENCOMPUTER-DEMONSTRATIONSAUFBAUTEN ERFAHREN SIE HIER:
https://www.quantentechnologien.de/forschung/foerderung/quantencomputer-demonstrationsaufbauten.html
Hintergrund:
Das Projekt »Quantum Ecosystem Deutschland (Q.E.D.)« hat zum Ziel, den Aufbau souveräner Innovations- und Wertschöpfungsnetzwerke im Quantencomputing in Deutschland wissenschaftlich zu begleiten. Das in zwei Module unterteilte Projekt soll dazu beitragen, Handlungswissen und Strategien für den mittel- bis langfristigen Aufbau eines technologisch souveränen und international wettbewerbsfähigen Quantencomputing-Ökosystem zu entwickeln. Dafür werden neue Methoden und Instrumente der Ökosystemanalyse entwickelt und Begleit- und Vernetzungsformate pilotiert.
Das Vorhaben mit dem Förderkennzeichen 13N16465 wird im Rahmen des Förderprogramms »Quantentechnologien - von den Grundlagen zum Markt« vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert
Ihre Ansprechpartner:
Fraunhofer IMW Neumarkt 9-19, 04109 Leipzig
Kommunikation: Dirk Böttner-Langolf Telefon: +49 341 231039-250 |
dirk.boettner-langolf@imw.fraunhofer.de
Regionale Transformation und Innovationspolitik: Dr. Friedrich Dornbusch, Telefon: +49 341 231039-401 | friedrich.dornbusch@imw.fraunhofer.de
Das Fraunhofer IMW blickt auf mehr als achtzehn Jahre angewandte, sozioökonomische Forschung und Erfahrung in internationalen Projekten am Standort Leipzig zurück. Für den langfristigen Erfolg von Kunden und Partnern aus Wirtschaft, Industrie, Forschung und Gesellschaft entwickelt das interdisziplinäre Team wissenschaftlich fundierte Lösungen für die Herausforderungen der Globalisierung. Das Institut und seine Köpfe besitzen ausgewiesene Kompetenzen in den Bereichen Internationalisierung, Innovations- und Technologiemanagement, Technologieökonomik, Strukturwandel, regionale Transformation, Daten- und Plattformökonomie, digitale Wertschöpfung, Strategieentwicklung und Wissensökonomie. Ursprünglich als Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa MOEZ im Jahr 2006 gegründet, kommt die inhaltliche und strategische Neuausrichtung des sozio- und technoökonomischen Instituts der Fraunhofer-Gesellschaft seit 2016 im neuen Namen Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW zum Ausdruck. Das Center for Economics and Management of Technologies ergänzt das Portfolio des Leipziger Fraunhofer IMW als dessen Außenstelle in Halle (Saale) um werkstoffwissenschaftliche und technoökonomische Expertise. Der Übergang in das Fraunhofer IMW erfolgte zum 1. Januar 2020. Damit ist das Fraunhofer IMW neben dem Standort im Freistaat Sachsen zusätzlich in Sachsen-Anhalt vertreten.